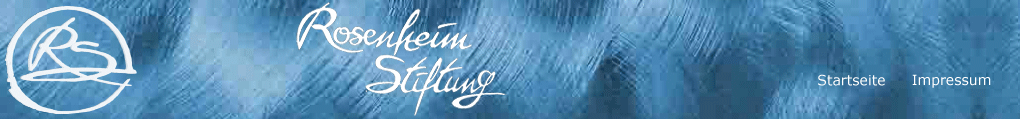
ÜBER UNS
|
| • STIFTUNGSGEDANKE |
| • AUFGABEN |
| • ARBEITSPROGRAMM |
| • THEMEN |
| B. G. ROSENHEIM |
| KUNSTPREIS |
| KONTAKT |
B. G. ROSENHEIM: |
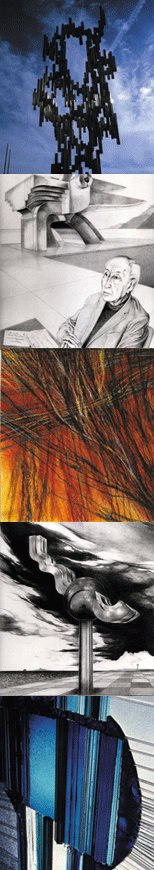
Bernd Rosenheim:
RICHTUNGSGEBENDE GEDANKEN ZUM STIFTUNGSZWECK
„Soupsuds and whitewash“ nannte ein Kritiker das Gemälde „Snowstorm and Steamboat off Harbour – mouth“, das in der Tate Gallery hängt. Der Kritiker ist vergessen, nicht aber der Schöpfer des Bildes, William Turner. Und jeder Kunstinteressierte lacht heute über dieses Urteil. Denn Turner schuf in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit diesem Werk eine künstlerische Sprache, die erst heute, Ende des 20. Jahrhunderts, verstanden wird.
Solche Fehlurteile, wie sie zu Dutzenden überliefert sind, stellen geradezu einen Schlüssel dar für das Elend der heutigen Kunstkritik, ja der gesamten zeitgenössischen Kunst.
Wie ein Menetekel stehen sie Kritikern und Kunstexperten – mit einigen Ausnahmen – vor Augen. Sie alle möchten auf der Höhe der Zeit stehen. Es scheint für die meisten eine Horrorvision zu sein, sich zu irren. Der einfachste Weg, dem zu entgehen, ist alles gut zu heissen, was im Kunstbetrieb auftaucht, jedem Trend zu folgen, der gerade en vogue ist. „Ich mag sie zwar nicht“, äusserte einmal ein Kritiker eines bekannten Kunstmagazins, als die „Neuen Wilden“ aufkamen, „aber es ist immer besser, sich auf die Seite der Künstler zu stellen“.
Dabei sind es heute gar nicht mehr die Künstler, welche die Entwicklung bestimmen. Kunst wird heute von einflussreichen Kunstvermittlern und Kunsthändlern „gemacht“. Während die Kunstvermittler (Ausstellungsmacher, Journalisten usw.) sozusagen die ideologische Seite der Kunst bearbeiten, suchen die Kunsthändler, gestützt auf deren Interpretationen, ihre Künstler bei Sammlern und anderen potentiellen Kunden durchzusetzen, nicht zuletzt mit Argumenten des Marktes, also erzielbarer Preise.
Einer der einflussreichsten Kunsthändler der Pop-Art-Stars, der Lichtenstein, Rauschenberg und andere gross gemacht hat, Leo Castelli, äusserte einmal, dass er damals, als die Künstler noch jung und unbekannt waren, mindestens noch ein Dutzend anderer begabter junger Künstler gehabt habe. Aber er habe auf die gesetzt, die später einmal gross wurden – und somit recht behalten. Das aber ist nichts anderes als „selffulfilling prophecy“, denn hätte er sich um andere ebenso gekümmert, wie um die späteren Stars, so hätte er auch sie durchgesetzt.
Nur Künstler, die so in den Marktkreislauf gelangt sind, gelten als relevant, besonders dann, wenn ihr Preisniveau ihnen internationale Aufmerksamkeit sichert. Dass die Preise, die für zeitgenössische, sogenannte „Spitzenkünstler“ (als handle es sich bei der Kunst um einen olympischen Wettbewerb) gezahlt werden, in gar keinem Verhältnis stehen zur künstlerischen Leistung, zeigt allein schon der Vergleich mit Preisen für Werke alter Kunst. Es herrschen die Gesetze des Marktes, die nichts zu tun haben mit der künstlerischen Bedeutung eines Werkes oder eines Künstlers. So offensichtlich diese Tatsache ist – sie lässt sich hundertfach belegen – so verbreitet ist der Glaube an die Übereinstimmung von Marktwert und Kunstwert. Es scheint ein sicherer Massstab zu sein auf einem Feld, wo scheinbar alle verlässlichen Massstäbe verloren gegangen sind. Dieser Irrtum wird propagiert durch Theorien, die den Warencharakter von Kunstwerken betonen. Den können sie ohne Zweifel annehmen. Schliesslich ist der Markt imstande, jeden Gegenstand in Ware zu verwandeln. Dem Sog des Marktes erliegen nicht wenige Künstler und sie richten ihre Produktion nach ihm aus, was wiederum der gerade den Markt beherrschenden Tendenz Recht zu geben scheint.
„Kauft breite Pinsel, der Trend hält noch an!“, ist der überlieferte Schlachtruf eines Galeristen an seine Mannschaft „Neuer Wilder“.
Es dürfte heute also kaum einem Künstler gelingen, allein Kraft seiner Begabung sich durchzusetzen. Förderung durch Galerien und Institutionen müssen hinzukommen und nicht zuletzt P. R.-Strategien. Ein Ästhetik-Professor (Bazon Brock) ist sogar der Auffassung P. R. und Selbstvermarktung gehörten zum künstlerischen Prozess. Ein solches Verständnis künstlerischer Arbeit entspringt gewissen Auffassungen von der Erweiterung des Kunstbegriffes, die sich nachhaltig in den Kriterien niederschlagen, wonach zeitgenössische Kunst heute vorwiegend beurteilt wird. Es sind dies im Wesentlichen: Innovation, Botschaft, Idee. Nicht zu unterschätzen sind die Zufälligkeiten von Geschmacksurteilen, die sich erst gar nicht begründen und die von erheblichem Einfluss sein können, wenn sie von entsprechenden Autoritäten kommen.
Innovationen: das sind echte oder vermeintliche Neuheiten, wie ungewöhnliche Materialien, Arrangement von Gegenständen, neue Medien u. ä.
Botschaften: das sind Bilder, Objekte oder Texte mit Schlagwort – oder Bekenntnischarakter.
Ideen: das kann alles nur Denkbare sein, solange es nur originell erscheint. Als „Idee“ in diesem Sinne gilt zum Beispiel, wenn Künstler Werke berühmter Meister kopieren und mit eigenem Namen signieren.
Es sind durchweg ausserkünstlerische Kriterien, welche das Moment der Gestaltung ausser acht lassen. Sie sind leicht verständlich und gut handhabbar. Da im Sinne des erweiterten Kunstbegriffes alles als kunstfähig angesehen werden kann, muss man sich nicht mehr der Mühe unterziehen, ein Werk nach formalen Gesichtspunkten zu untersuchen. Es genügt, seinen Inhalt verstanden zu haben oder die künstlerische Absicht. Was also verstanden wird, sind Ideologien, Privatideologien von Künstlern oder Ideologie ganz allgemein: der „ Zeitgeist“, Kunst als Spiegel ihrer Zeit.
Das ist sie naturgemäss, und zwar in allen ihren Ausprägungen, sie kann ja gar nicht anders, selbst wenn sie sich nicht mit aktuellen Themen befasst oder sozialkritisch gibt. Nur: nicht alles, was die Zeit spiegelt ist auch Kunst.
Innovationen, Botschaften, Ideen können natürlich, auch wenn sie nicht das Wesentliche eines Kunstwerkes ausmachen, gewisse Qualitäten bezeichnen, einen Komplex sekundärer Eigenschaften, die zum Verständnis und zur Beurteilung notwendig sind. Man könnte dem hinzufügen: Phantasie, Humor, Intelligenz u. a. m.
Kulturfunktionäre, Ausstellungsmacher, Journalisten beteuern gern und immer wieder, dass sie bei ihrer Arbeit von den Produktionen der Künstler abhängen. So einleuchtend das klingt, so falsch ist es. Wie auf dem Kunstmarkt verhält es sich genau umgekehrt. Denn es sind ja gerade diese Leute, die im Kunstbetrieb das Sagen haben und welche entscheiden, wer und was darin zugelassen wird, wen und was sie für „wichtig“ halten. So werden Trends gesetzt und ein Grossteil der Künstler folgt ihnen, weil sie, wer will es ihnen verdenken, den Erfolg suchen. Wieviele Begabungen dabei auf der Strecke bleiben, weil sie sich nicht frei und ihrem Talent gemäss entwickeln, lässt sich nur ahnen. Ein Trend lässt sich aber nur durchsetzen – was freilich nicht immer gelingt – wenn Sammler und Institutionen mitziehen. Das heisst, wenn sie überzeugt werden können mit Begründungen wie Innovation, Ideengehalt, Marktwert.
Getragen von einer weit verbreiteten Expertengläubigkeit können – selbst bei Werken minderer Qualität – solche Argumente nur deshalb verfangen, weil in der modernen Industriegesellschaft eine breite Schicht von Connaisseuren fehlt, wie es sie etwa in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts gegeben hat oder im Florenz des 15. Jahrhunderts.
Angesichts dieser Situation kommt es Don Quijotes Kampf mit den Windmühlen gleich, wenn eine kleine Stiftung versucht, solchen Tendenzen entgegenzusteuern. Dies soll aber ihr Ziel sein.
Wie kann sie das tun? Mir scheint allein dadurch, dass sie ohne Rücksicht auf herrschende Meinungen oder Stilrichtungen, Preisniveau oder Renomé eines Künstlers nur solche Kunst fördert, die gestalterischen Gesichtspunkten folgt.
Bei der Auswahl von Preisträgern oder bei Ankaufsentscheidungen soll sich die Jury von nichts anderem leiten lassen, als von solchen Qualitäten eines Oeuvres bzw. eines Einzelwerkes, d.h. von der Überzeugungskraft der Form, nicht zuletzt dann, wenn sich ein gedanklicher Inhalt aussprechen will. Er muss im künstlerischen Ausdruck, im bildnerischen Vorgang, im optischen Erscheinungsbild, also in der Formsprache des Werkes anschaulich werden. Dagegen darf bei der Beurteilung keine Rolle spielen, ob die Werke gegenständlich oder abstrakt sind, ob sie einem herrschenden Trend folgen oder eine Aussenseiterposition einnehmen.
Die Beschränkung auf drei klassische Disziplinen der bildenden Kunst – Handzeichnungen, Malerei, Skulptur – worin sich nach wie vor die Mehrzahl der Künstler ausdrückt, entspricht den heutigen Möglichkeiten der Stiftung. Eine künftige Ausweitung auf andere Gebiete der bildnerischen Künste soll aber nicht ausgeschlossen werden, sofern es die finanziellen und räumlichen Gegebenheiten erlauben. Anlass dafür könnte sein, wenn sich auf anderen Feldern relevante und förderungswürdige Entwicklungen abzeichnen.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass die von mir umschriebenen Auswahlkriterien, dass Begriffe wie „Gestaltung“ und „Form“ der Interpretation offen stehen und dass diese Kriterien immer nur angesichts des konkreten Werks ihre Tragfähigkeit erweisen können. Ich glaube jedoch, dass sie als wesenhafte Eigenschaften eines Kunstwerkes anwendbar und gültig bleiben, auch wenn die Kunst ständig im Fluss ist. Sie werden jedoch Irrtümer und Fehlurteile nie völlig ausschliessen können, denn als Urteilende sind wir stets unserer Zeit verhaftet. Insofern kann eine Bewertung nie endgültig sein. Wir wissen, wie sich das Bild selbst bedeutender Künstler in den Augen wechselnder Generationen gewandelt hat.
„Den Stoff sieht jeder vor sich,
den Gehalt nur der, der etwas hinzuzutun hat,
und die Form ist ein Geheimnis den meisten.“ (Goethe)
Kenmare, den 1. Januar 1994